|
Montag, 3. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Jedes vierte Opfer in Familie wird mit Armeewaffe getötetBern - Bei tödlichen Familiendramen greift der Täter meistens zu einer Schusswaffe. Dabei wird in einem Viertel der Fälle mit einer Waffe aus der Armee getötet. Das zeigt eine neue Studie aus Lausanne. Sie könnte der Initiative «Schutz vor Waffengewalt» Auftrieb verleihen.tri / Quelle: sda / Montag, 8. Februar 2010 / 12:25 h
Die Studie untersuchte 75 Delikte, bei denen der Täter zuerst sein(e) Opfer und dann sich selber tötete. Die Fälle stammen aus zehn Kantonen aus den Jahren 1981 bis 2004. In drei Viertel der sogenannten erweiterten Suizide griff der Täter zu einer Schusswaffe. In einem Viertel dieser Fälle waren es Armeewaffen.
In einem weiteren Viertel (28 Prozent) konnte die Herkunft der Waffe nicht rekonstruiert werden, weil sie beispielsweise von der Polizei nicht protokolliert wurde.
Familiendramen: In einem Viertel der Fälle wird mit einer Armeewaffe getötet. /
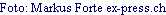 Die restlichen Waffen - rund die Hälfte - stammte aus Privatbesitz. Strengeres Waffengesetz In der Zusammenfassung der Studie, die Ende Januar im «American Journal of Forensic Medicine and Pathology» erschien, folgern die Autoren: «Ein strengeres Waffenrecht in der Schweiz könnte ein Faktor in der Prävention von erweiterten Suiziden sein.» Erstautorin ist die Rechtsmedizinerin Silke Grabherr vom Institut für Rechtsmedizin am Unispital Lausanne. Als einer der weiteren Autoren fungiert der Zürcher Strafrechtsprofessor Martin Killias, der bereits eine ähnliche, auf Hochrechnungen basierende Studie publiziert hatte. «Hemmschwelle sinkt mit Armeewaffe» Nationalrätin Chantal Galladé (SP/ZH), eine der Initiantinnen der Volksinitiative «Schutz vor Waffengewalt», ist von den Zahlen nicht überrascht. «Man weiss, dass erweiterte Suizide oft mit Schusswaffen begangen werden», sagte sie auf Anfrage. Mit solchen könne aus Distanz getötet werden, was die Hemmschwelle senke. Die Initiative «Schutz vor Waffengewalt» will Armeewaffen aus privaten Haushalten verbannen. Auch sollen alle Schusswaffen zentral registriert werden. Wer eine Waffe besitzen will, soll nachweisen müssen, dass er eine solche benötigt und entsprechende Fähigkeiten mitbringt.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|