|
Samstag, 1. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Birmesischer FrühlingWas vor einem Jahr noch niemand für möglich gehalten hätte, wird Wirklichkeit. Myanmar - im Westen besser bekannt unter dem Namen Birma - entwickelt sich langsam aber sicher in Richtung Demokratie. Ein burmesischer Frühling, sozusagen.Peter Achten / Quelle: news.ch / Dienstag, 21. Februar 2012 / 16:00 h
Die ersten Wahlen seit zwanzig Jahren Ende 2010 bezeichneten Kommentatoren westlicher Qualitätszeitungen - auch in der Schweiz - als Farce. Das waren sie zum grössten Teil wohl auch. Aber nicht nur. Jüngere Elemente der Opposition stellten sich - nach dem Wahlboykott der Nationalen Liga für Demokratie NLD unter Menschenrechts-Ikone Aung San Suu Kyi - dennoch den Wählerinnen und Wählern unter dem Namen Neue Demokratische Kraft. Einige Vertreter dieser jüngeren Generation von Politikern schafften es wider Erwarten ins neue Parlament. Diese Volksvertretung in der Hauptstadt Naypyitaw wird - qua Verfassung - noch immer von den seit 1962 regierenden Militärs beherrscht. Aber auch hier beginnt sich eine neue, jüngere Generation in Uniform Gehör zu verschaffen und durchzusetzen.
Wer nicht aus dem redaktionellen Elfenbeinturm der Zeitungen kommentierte, sondern Myanmar seit Jahren kennt, wusste also bereits vor einem Jahr, dass grosse Veränderungen anstehen. Als im März 2011 der ehemalige Ministerpäsident Thein Sein zum Staatspräsidenten, diesmal nicht in Uniform sondern in Zivil, ernannt wurde, runzelten viele die Stirm. Thein Sein nämlich war nicht nur General sondern auch engster Vertrauter des langjährigen Despoten und General Nummer 1 Than Schwe. Kaum an der Macht, begann er aber zügig mit Reformen. Die Medienzensur wurde gelockert, politische Gefangene kamen frei, Gewerkschaften wurden erlaubt, Friedensgespräche mit ethnischen Rebellen kamen in Gang, und die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit vom grossen Nachbarn im Norden, China, wurde gelockert. Das Verhältnis zu den USA und Europa begann sich zu entspannen.
Schon vor dem Machtantritt Thein Seins wurde die Wahlsiegerin von 1990 und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi - Tochter des Staatengründers und Nationalhelden Aung San - aus dem Hausarrest entlassen. Suu Kyi - in Myanmar äusserst populär und liebevoll «the Lady» genannt - verbrachte über fünfzehn Jahre in Gefangenschaft. Jetzt, nach der von ihrer NLD-Partei boykottierten Wahl, wurde sie wieder aktiv. Und wie. Verschiedentlich hat sie sich mit Präsident Thein Sein in der Hauptstadt Naypyitaw getroffen, und die Gespräche sollen im «besten Einvernehmen» abgelaufen sein. Im November kam es mit dem Segen der Militärs in Yangon zur emotionalen Begegnung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit der amerikanischen Aussenministerin Hillary Clinton.
Wenig später wurde bekannt, dass Suu Kyi in Nachwahlen für 48 Sitze am 1. April sich als Kandidatin stellen werde. In diesem Parlament, das sie vor einem Jahr noch als «illegitim» abqualifizierte, wird sie nun dank ihres Charisma und ihrer Beliebtheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Sitz erobern. Zu Beginn des Wahlkampfes gab sie sich versöhnlich: «Wir müssen unsere Schwierigkeiten in Eintracht überwinden». Welche Rolle die «Lady» nach einem Wahlsieg spielen wird, ist offen. Präsident Thein Sein hat bereits durchblicken lassen, dass eventuell ein wichtiges Regierungsamt möglich sei. Ebenso wahrscheinlich ist, dass Suu Kyi die Rolle der klassischen Oppositionsführerin übernehmen könnte. Selbst bei einem durchschlagenden Sieg der wieder zugelassenen Nationalen Liga für Demokratie bei den Nachwahlen am 1. April kann sie die Dominanz der militärnahen Partei USDP im Parlament nicht brechen. Per Verfassung haben überdies die Uniformierten ein Viertel der Parlamentssitze auf sicher.
Auch Präsident Thein Sein mischt sich - so gehört es sich in einer Demokratie - in den Wahlkampf: «Die Nation freut sich auf die demokratische Wahl. Die Regierung respektiert die Stimme des Volkes».
Ob mit oder ohne Aung San Suu Kyi (hier bei einer Rede am 12. Januar): Ohne Überwindung der Armut wird die Demokratie in Myanmar scheitern. /
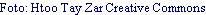 Thein Sein fügte an die Adresse des grossen Nachbarn China aber auch der Vereinigten Staaten selbstsicher hinzu: «Birma braucht weiter eine starke Armee, um nicht dem Faustrecht der Supermächte ausgesetzt zu sein». Sowohl der birmesische Präsident als auch die birmesische Oppositionsführerin habe so innerhalb kürzester Zeit einen politischen Salto Mortale vollzogen, ganz in der pragmatischen Weise, die für Asien so typisch ist. «Kreide haben beide gefressen», mokiert sich dagegen ein NLD-Mitglied der alten Generation. Noch bleibt viel zu tun. Noch immer sitzen hunderte von politischen Gefangenen in burmesischen Kerkern. Noch boykottieren die USA und die EU das Land. Der lange Weg von der Diktatur zur Demokratie jedenfalls ist eingeschlagen. Vieles, wenn nicht alles, hängt wohl davon ab, wie in den kommenden Monaten und Jahren die Wirtschaft sich entwickeln wird. Myanmar galt kurz nach der Unabhängigkeit von den englischen Kolonialherren am Ende der 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts als Reiskammer Asiens. Ökonomen und andere Experten prognostizierten dem Land eine brillante Zukunft und schnellste ökonomische Entwicklung. Es sollte anders kommen. Nach über einem Jahrzehnt chaotischer Demokratie übernahmen 1962 die Generäle unter dem Kommando von Ne Win die Macht. Mit einem Wirtschaftsmodell, das den tiefgläubigen Birmesinnen und Birmesen als «buddhistischer Sozialismus» verkauft worden war, verarmte das Land vollends. Eine kleine, extrem korrupte, von den Militärs angeführte Schicht verdiente sich fortan jahrzehntelang eine goldene Nase mit Ausbeutung der Armen, mit Schmuggel von Waren aller Art und Drogenhandel. Myanmar indes ist ein an Naturschätzen reiches Land: Grosse Erdöl- und Erdgas-Vorkommen, Rubine und Jade, fruchtbarer Boden im Irriwaddy-Delta - um nur weniges zu nennen. Trotzdem ist Birma eines der allerärmsten Länder - nicht nur Asiens, sondern der ganzen Welt. Über dreissig Prozent der 57-Millionen-Bevölkerung lebt nach UNO-Normen in absoluter Armut. Die Infrastruktur des Landes - Strassen, Eisenbahnen, Elektrizität - ist in einem desolaten Zustand, desgleichen das Gesundheits- und Erziehungssystem. Mit der Öffnung und schnellen Reformen versprechen sich jetzt viele einen grundlegenden Wandel. Bei meinem letzten Besuch war unschwer festzustellen, dass sich nicht mehr nur Investoren aus den grossen Nachbarländern Indien und China sowie Thailand und Singapur für Geschäftsmöglichkeiten in Myanmar interessieren. Vertreter grosser internationaler Multis - darunter selbstverständlich auch Schweizer - gaben sich in den burmesischen Wirtschaftsmetropolen Yangon und Mandalay die Türklinken bei Ministerien, der Regierungspartei genauso wie bei der Opposition in die Hand. Offen wollte noch niemand darüber reden. Kein Wunder, denn die - im übrigen wirkungslosen - Sanktionen von Seiten der USA und der Europäischen Union sind noch nicht aufgehoben. Die junge Generation in den Städten jedenfalls ist voller Hoffnung. Ob jedoch die Reformen bereits unumkehrbar sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Aung San Suu Kyi liess sich anfangs Jahr nur so viel entlocken: «Ich bin vorsichtig optimistisch». Mit der Wahlteilnahme im April hat sie wohl ein noch eindeutigeres Zeichen gesetzt. Ein reformorientierter Minister andrerseits - so wird es unter Oppositionellen in Yangon, Bago, Pathein und Mandalay kolportiert - soll gesagt haben, dass von den sechzig wichtigsten Entscheidungsträgern Myanmars sich derzeit zwanzig klar für Reformen einsetzten, weitere zwanzig noch schliefen und die restlichen zwanzig abwarteten, auf welche Seite sie sich schlagen sollen. Viele der gebildeten Städter sind der Meinung, dass es nach sechzig Jahren Militärherrschaft ganz einfach keine andere Wahl gibt. Mein langjähriger Bekannter U Myint Aung bringt das Offensichtliche am besten auf den Punkt: «Ohne Beseitigung der Armut wird es in Myanmar keine Demokratie und mithin keinen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Fortschritt geben - mit oder ohne Aung San Suu Kyi».
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|