|
Mittwoch, 5. Juli 2023 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Koreakonflikt: Der bittere Geschmack des Kalten KriegesArtilleriegranaten und Raketen schlagen auf einer Südkoreanischen Insel ein, Minuten später werden 80 Granaten aus Südkorea abgefeuert. Die Welt steht fassungslos daneben, während die staatlichen Medien von Nordkorea Propaganda-Meldungen verbreiten und Südkorea unerträgliche Provokationen vorwirft, und konkret nur etwas nennt, das noch gar nicht statt gefunden hatte: Ein gemeinsames See-Manöver der USA mit Südkorea.von Patrik Etschmayer / Quelle: news.ch / Freitag, 26. November 2010 / 13:03 h
<
Die Motivation dieses Wahnsinns ist für westliche Beobachter ziemlich mysteriös, ebenso die Frage, warum China seinen Einfluss nicht stärker ausspielt. Eine Interpretation der jüngsten Ereignisse ist, dass der todkranke Diktator Kim Jong-il seinem jüngsten Sohn und designierten Nachfolger Kim Jong-un eine stärkere Position verschaffen wolle, indem dieser sich in einem Konflikt mit dem Todfeind im Süden bewähren soll, damit nach dem Ableben von Kim Jong-il nicht das Militär nach der Macht greift.
Doch nicht diese an Palastintrigen mahnende Spielchen hinter der Kulisse beunruhigen – es ist vor allem die Nonchalance, mit der hier Menschenleben genommen und geopfert werden, um sicher zu stellen, dass der kleine Prinz auch ganz sicher auf den Thron steigen wird.
Bei etwas älteren Menschen mischt sich allerdings diese Irritation mit einem Gefühl des Déjà-Vu, die Erinnerung an eine Zeit, in der die ganze Welt ähnlich irr drauf gewesen ist. Wer Ende der 80er Jahre schon mehrere Jahre lang nicht mehr mit Matchbox-Autos, Barbies oder Fischer-Technik gespielt hatte, fühlt sich geradezu in jene Jahre zurück katapultiert, in der die ganze Welt eine Hot-Zone gewesen ist und für uns Westler das Böse mit dem Namen Breschnjew in Moskau sass.
Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze gehörten damals ebenso zum täglichen Nachrichten-Brot wie Konfrontationen in allen möglichen globalen Nahtstellen der Machtblöcke des kalten Krieges. Bürgerkriege in Afrika und Asien waren der Hintergrundlärm, eine Art rosa Rauschen des Todes, während über allen das Damoklesschwert der totalen nuklearen Auslöschung hing.
Wo der kalte Krieg konserviert wird: Die Innerkoreanische Grenze /
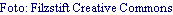 US-Kriegsschiffe und russische Flottenverbände gerieten immer wieder aneinander und wenn mal irgend ein solcher Pot absoff und ein «feindlicher» Flottenverband in der Nähe des Unglücksortes stationiert gewesen war, wurde der Thermostat des kalten Krieges sofort einige grade nach oben gedreht. Jeweils mit dem Resultat, dass die generelle Angst vor der totalen Vernichtung aus der täglichen Verdrängung nach oben kam. Das Leben in den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren war nicht von einer eingebildeten, sondern einer ständigen konkreten Angst erfüllt, die Angst, in einem kurzen, heftigen Atomkrieg ausradiert zu werden. Die heutige Zeit mit Islamismus, Rezession, Kultur-Kampf und Finanzkrise kommt vielen Menschen schlicht schrecklich vor, zu Recht. Aber wer genug lange zurück denken kann, wird durch das Duell an der koreanischen Grenze plötzlich wieder den Geschmack des Kalten Krieges auf der Zunge schmecken, den Geschmack der ständig präsenten Angst vor dem sofortigen Ende, mit einer Vorwarnzeit, die gerade dazu gereicht hätte, den atomaren Gegenschlag auf die Reise zu schicken um dafür zu sorgen, dass es wirklich keinen Sieger gegeben hätte. Das geteilte Korea ist ein Überrest aus dieser Zeit des erstarrenden Schreckens, eine ständige Erinnerung daran, was wir in Zukunft verhindern müssen. Doch genau das Gegenteil könnte der Fall sein. Statt das geteilte Korea behutsam zu vereinigen scheint es der Ausgangspunkt von neuen Machtblöcken zu werden, wobei diesmal China der grosse Antagonist der USA werden könnte. Ein Menü, auf das keiner scharf sein kann, der sich noch erinnern kann, wie bitter das letzte solche Duell schmeckte.
 «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|