|
Sonntag, 11. August 2024 |
VADIAN.NET, St.Gallen |
|
|
||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Innovative Verbesserungen durch Aerogel-Anwendungen im BaubereichIm Juli fand die vierte Verleihung des «Aerogel Architecture Award» auf dem Empa-Campus statt. Insgesamt wurden sechs Projekte in den Kategorien «Realisierte Lösungen» und «Studierendenprojekte» ausgezeichnet.fest / Quelle: baugewerbe.ch / Sonntag, 11. August 2024 / 13:58 h
Diese Projekte zeigen die Anwendung von Aerogel-Materialien in Architektur- und Bauprojekten, die durch geringfügige Eingriffe in die Bausubstanz und das Erscheinungsbild erhebliche Einsparungen bei Wärmeverlusten und Energieverbrauch ermöglichen.
Die Gewinner waren ein Sanierungsprojekt aus Italien und ein studentisches Konzept aus Brasilien. Für den diesjährigen «Aerogel Architecture Award» wurden Projekte gesucht, die beispielhaft zeigen, wie das leistungsstarke Dämmmaterial Aerogel bei Renovierungen historischer Gebäude sowie in der Architektur und im Bauwesen im Allgemeinen eingesetzt werden kann. Aus insgesamt 31 Einreichungen für die beiden Kategorien «Realisierte Lösungen» und «Studierendenprojekte» wählte die Fachjury jeweils drei Gewinner aus. Die Vertreter der umgesetzten Projekte wurden zur Preisverleihung im NEST, dem Forschungs- und Innovationsgebäude von Empa und Eawag, eingeladen. Energetische Modernisierung historischer GebäudeIn der Kategorie «Realisierte Projekte» wurden fünf Projekte eingereicht: eines aus China, eines aus Italien und drei aus Deutschland. Das Projekt «Stringi-Stringi» aus Livorno, Italien, setzte sich schliesslich durch. Es handelte sich um die Renovierung des gleichnamigen Sozialwohnungsbaus, durchgeführt vom Architekturbüro SB Ingegneria. Um das schlecht isolierte Gebäude von 1939 energetisch zu verbessern, wurden fünf entscheidende Massnahmen an der Struktur durchgeführt: Das Dach erhielt eine 140mm dicke Schaumstoffisolierung, die Fassade wurde mit EPS 100 Graphit oder einer 50mm Aerogel-Schicht saniert. Die alte Gasheizung wurde durch eine Wärmepumpe ersetzt und auf dem Dach wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert.Zudem wurden die Fenster ausgetauscht und mit einer 10mm Aerogel-Schicht abgedichtet. Besonders für die Sanierung der Fassade des V-förmigen Gebäudes war der Einsatz von Aerogel entscheidend, so die Architektin Serena Braccini. Die Jury war ebenfalls von diesem Einsatz des leistungsstarken Aerogel-Materials überzeugt: «Das für die faschistische Epoche typische Gebäude des Architekten Ghino Venturi konnte energetisch auf den heutigen Standard gebracht werden, ohne das optische Erscheinungsbild zu beeinträchtigen», fasst Jury-Mitglied Volker Herzog zusammen. Das Gebäude als Ganzes wurde fit für das nächste Jahrhundert gemacht. Auf den zweiten Platz kam der Kindergarten Eversbuschstrasse in München. Das Team des Architekturbüros bodensteiner fest Architekten wurde beauftragt, das 120-jährige Gebäude, das zuletzt 20 Jahre lang leer stand, mit einfachen Mitteln aufzuarbeiten und ihm so ein neues Leben zu geben. Zukünftig wird es als Integrationskindergarten genutzt werden, wobei die begrenzten Platzverhältnisse eine grosse Herausforderung in der Planung darstellten, so die leitende Architektin Annette Fest. Zentral für das Projekt war die Erhaltung bzw. Wiederverwendung vorhandener Materialien und Strukturen, wobei das hochgradig wärmedämmende Aerogel-Material grösstmögliche Freiheiten bot. Das Projekt rund um das Andreas-Schubert-Gebäude an der Technischen Universität Dresden, ausgeführt vom Büro IPROconsult, erreichte den dritten Platz. Das Andreas-Schubert-Gebäude der Technischen Universität Dresden. /
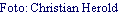 Innenansicht des Projekts Tassi Museum. /
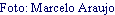 Das Fakultätsgebäude, erbaut im Jahr 1959, steht unter Denkmalschutz und musste daher unter Berücksichtigung der materiellen Struktur saniert werden. Es besteht aus einem Betongerüst, in das dünnere Betonpaneele und Fenster integriert sind. Im Zuge der Sanierung wurden die Betonpaneele mit einer 50 mm dicken Aerogel-Dämmung versehen und neue Fenster eingebaut. Diese Massnahmen führten zu einer Reduzierung des Wärmeverlusts um etwa 75 Prozent, während die charakteristische Fassade erhalten blieb. Auszeichnungen für Studentinnen und StudentenUnter den insgesamt 26 Studierendenprojekten aus verschiedenen Ländern wurde das Projekt «Tassi Museum» des brasilianischen Duos Amanda Sayuri Hashimoto und Guilherme Pinheiro e Silva mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Ihr Konzept sieht vor, das ehemalige «Hotel Tassi» in Curitiba, das durch einen Brand stark beschädigt wurde, umfassend zu renovieren und in ein Museum umzuwandeln. Dabei soll sowohl die ursprüngliche Architektur als auch die Geschichte des Hauses berücksichtigt werden. Die alte, teilweise beschädigte Ziegelwand soll durch eine neue Holzkonstruktion gestützt werden. Eine Aerogel-Isolation an der Fassade ermöglicht es dem Gebäude, «zu atmen», was die Wärmedämmung verbessert, ohne dass sich Feuchtigkeit zwischen Innen- und Aussenwand ansammeln kann.Zusätzlich zur Fassadenisolation ist im Projekt eine Überdachung des Innenhofs geplant, bestehend aus einer 30 mm dicken Aerogel-Schicht zwischen zwei Glasscheiben. Dadurch kann Tageslicht in den Innenhof gelangen und dieser wetterunabhängig genutzt werden. Die Jury betrachtet diese beiden Anwendungen als optimalen Einsatz des innovativen Aerogel-Materials, wobei «ein Maximum des bestehenden Gebäudes und dessen Struktur bewahrt bleibt», so Jury-Mitglied Beat Kämpfen. Besonders positiv bewertet wurde die Kombination aus der alten, sichtbaren Ziegelsteinwand und der neuen Holzstruktur, die der Fassade zusätzliche Stabilität verleiht. Auf dem zweiten Platz befindet sich das Projekt von Patricia Malota aus Polen. Sie hat ein städtisches Zentrum für psychische Gesundheit in Krakau entworfen, das hauptsächlich lichtdurchlässige Aerogel-Fassaden aufweist. Besonders die Therapieräume profitieren von einer hellen und einladenden Atmosphäre, wobei die Privatsphäre jederzeit geschützt ist, so die Jury. Den dritten Platz belegt das Konzept von Michael Chang und Adrian Corbey von der Harvard University in Cambridge, USA. Mit ihrem «Aeroblock» präsentieren sie eine innovative Lösung für das Carpenter Centers for Visual Arts, entworfen von Le Corbusier: Die Fassade aus Glasblöcken des zeitlosen Gebäudes bietet keine Isolation, was zu starken Temperaturschwankungen im Innenraum führt. Durch neue «Aeroblöcke», die die gläsernen Steine ersetzen sollen, verleihen die beiden Studenten der Fassade eine zeitgemässe Isolation, ohne die faszinierende Optik zu beeinträchtigen. Zusätzlich zu den Auszeichnungen erhielten die Top-3-Studierendenprojekte Preisgelder in Höhe von 1500, 1000 und 500 Franken.  «Ausländer-Kredit» für Investitionen in der Heimat? Immer öfter - gerade auch vor den Ferien - wird das Beratungsteam von kredit.ch angefragt, ob auch in der Schweiz lebende Ausländer die Möglichkeit haben, einen günstigen, fairen Kredit zu erhalten. Fortsetzung
Endlich: SMS versenden mit Outlook 2007/2010 St. Gallen - Das mühsame Getippe ist vorbei. Als erster Schweizer Anbieter stellt ASPSMS.COM eine Anbindung an den Mobile Service von Microsofts Outlook 2007/2010 zur Verfügung. Ohne zusätzliche Software können SMS bequem via Outlook 2007/2010 versendet werden – und das auch noch günstiger als mit dem Handy. Fortsetzung
Radiolino - Grosses Radio für kleine Ohren Radiolino ist das erste deutschsprachige Web-Radio der Schweiz für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Das Programm richtet sich aber auch an Eltern, Grosseltern, Onkeln und Tanten, sprich an die ganze Familie.
Fortsetzung
Letzte Meldungen |
|
|